Das typische Klischee besagt, dass Männer die besseren Athleten sein sollen, wohingegen Frauen aus genetischer Sicht geringeres Potenzial für maximale körperliche Leistungen hätten. Während in der Forschung die meisten Studien rund um das Thema Sport immer noch an männlichen Probanden durchgeführt werden, da die Kontrolle der Ergebnisse nach den starken hormonellen Schwankungen im Zuge des weiblichen Menstruationszyklus nur sehr schwierig umsetzbar ist, räumen immer mehr neuere Untersuchungen mit dem vorherrschenden Mythos auf. Eine aktuelle Studie aus den USA zeigt sogar, dass genau das Gegenteil der Fall sein könnte [1].
In der weltweit ersten Studie ihrer Art untersuchten die Forscher 21 Gewichtheber auf Eliteniveau, die zusammengerechnet an drei Olympischen Spielen und 19 Weltmeisterschaften teilnahmen sowie 25 Nationalrekorde brachen und über 170 nationale und internationale Medaillen gewannen. Von den 15 weiblichen und sechs männlichen Teilnehmern wurden Muskelbiopsien des vastus lateralis, dem äußeren Kopf des Quadrizeps, durchgeführt, um darin die Verteilung der Muskelfasern zu bestimmen.
Im menschlichen Organismus werden Muskelfasern in drei Typen eingeteilt, die jeweils einen unterschiedlichen Anteil des Proteins MHC besitzen. Hierbei handelt es sich um eine mikroskopische Steuereinheit, die die Muskelfasern kontrahieren lässt. Wir unterscheiden die Typen MHC I (langsam zuckend), IIa (schnell zuckend) und IIx (super schnell zuckend). Genetisch gesehen sind jene Athleten am besten für Kraftsportarten, wie beispielsweise Gewichtheben, Kraftdreikampf aber auch Bodybuilding prädestiniert, die den höchsten Anteil an MHC II Muskelfasern aufweisen, da sie die meiste Kraft aufwenden können und das größte Potenzial für das Dickenwachstum besitzen.
Im Schnitt wiesen die 21 Probanden mit 67 Prozent den größten Anteil an Typ IIa Muskelfasern auf, der jemals dokumentiert wurde. Zwei der Frauen, die sich auf Weltklasseniveau befinden, hatten sogar stolze 85 Prozent der schnell zuckenden Fasern und damit mehr als jeder der Männer.
Jimmy Bagley, Professor der Kinesiologie an der San Francisco State University und Co-Autor der Studie, sagte:
„Trotz fehlender Daten dachte man lange, dass Frauen einen geringeren Anteil schnell zuckender Muskelfasern besitzen und dies wurde als nachteilig angesehen. Wir haben gezeigt, dass dem nicht so ist.“
Die Ergebnisse der Stichprobe deuten darauf hin, dass das Kaliber eines Athleten, dessen Trainingserfahrung sowie die Körpermasse den Anteil der schnell zuckenden Muskelfasern stärker bestimmt als das Geschlecht. Während man bisher annahm, dass die Verteilung der Muskelfasern angeboren sei, gibt die Studie zu verstehen, dass sie ebenso in einem gewissen Rahmen durch Training beeinflusst werden kann.
Kaylie Zapanta, die selbst als Gewichtheberin aktiv ist und an der Durchführung der Studie beteiligt war, kommentierte weiterhin, dass auch wenn Frauen sich in Bezug auf Hormone und den Körpertyp von ihren männlichen Kollegen unterscheiden, die Ergebnisse zeigen, dass sie aus Sicht der Muskelfaserverteilung keineswegs unterlegen sind. Männer besitzen aufgrund ihrer Veranlagung ein höheres Ausgangsniveau an Kraft und Muskelmasse. Der Grad, in dem diese beiden Parameter jedoch gesteigert werden können, ist zwischen den Geschlechtern identisch [2].
Primärquelle: sciencedaily.com/releases/2019/03/190327142058.htm
Literaturquellen:
- Serrano, Nathan, et al. „Extraordinary fast-twitch fiber abundance in elite weightlifters.“ PloS one 14.3 (2019): e0207975.
- Walts, Cory T., et al. „Do sex or race differences influence strength training effects on muscle or fat?.“ Medicine and science in sports and exercise 40.4 (2008): 669.



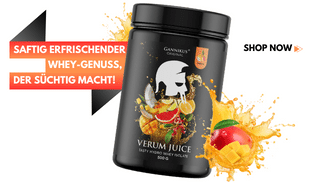


Was eine aussagekräftige Studie mit 21 Probanden. Außerdem noch 6 männlichen Teilnehmenden. Diese Anzahl ist extrem niedrig und damit ist die Studie nicht repräsentativ. Wenn sie nur 6 männliche Teilnehmende haben, ist doch klar, dass es eine Frau gibt, dessen Anteil an schnellzuckenden Muskelfasern höher ist. Je mehr Probanden bei den Männern teilnehmen, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, welche zu finden, mit größeren Anteil. 6 Teilnehmende sind nicht räpräsentativ für die männliche Bevölkerung. Außerdem gibts Studien, die zu anderen Ergebnissen kommen¹. Die Tatsache, dass Frauen beim Krafttraining schneller ermüden, spricht dafür, dass ihr Anteil an langsam zuckrnden Fasern größer ist. Bei einer Teilnehmer Anzahl von 21 Personen, können alle mögliche Ergebnisse rauskommen, weil der Zufall eine viel größere Rolle spielt und die Varianz größer ist.
Quelle¹: https://www.acefitness.org/continuing-education/prosource/june-2016/5926/battle-of-the-sexes-should-training-guidelines-for-men-and-women-be-the-same/
Was ist denn der Durschnitt bei Frauen und der Durschchnitt bei Männern, das würde mich auch interessieren, und nicht nur die Extremfälle. Weil es zwei Extremfälle von Frauen gibt, die mehr haben als jeder Mann und Teilnehmeranzahl bei Männern extrem niedrig sind, wäre es voreilig zu behaupten, dass es keine Unterschiede zwischen den Geschlechtern gibt. Wenn es keinen Unterschied in Bezug auf Geschleht gibt, wieso werden die Weltrekorde aller Gewichtsklassen von Männern gehalten, wenn sie doch keine Vorteile in Bezug auf Muskelfaserverteilung haben.